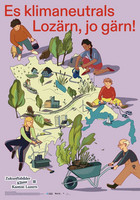Das Substrat wird abgekippt, eingebaut und es stellt sich heraus, es ist zu wenig. Wo liegt der Fehler? Was wurde bestellt und wie bestimmt man auf der Baustelle so wichtige Parameter wie Schüttdichte, Volumengewicht und Wassergehalt eines Substrates? Laut Johannes Prügl, leitendem Mitglied des Bodeninstituts Prügl, Au in der Hallertau (D), gibt es einfache Methoden, um diese Fragen direkt und schnell auf der Baustelle zu beantworten.
Schüttdichte
Um die Schüttdichte von mineralischen Substraten zu bestimmen, wird ein Messgefäss vorsichtig bis zum Rand befüllt und überschüssiges Material wird bündig mit der Gefässoberkante abgestrichen. Den abgewogenen Inhalt (abzüglich Eimergewicht) teilt man durch das Volumen des Gefässes, beispielsweise 10 l, und erhält so die Schüttdichte, die der DIN-EN 1097-3 entspricht.
Für diese Bestimmung bei humosen Kultursubstraten gilt die DIN 12580. Hierfür wird das Material in einen speziellen Messzylinder mit Aufsatz und Sieb locker eingefüllt. Simuliert man nun durch Rütteln und Schütteln den Transport per Lkw, beginnt bereits die
Verdichtung, was in beiden Testgefässen sehr deutlich zu sehen war. «Diesen optischen ‹Materialschwund› muss man bereits bei der Bestellung berücksichtigen, sonst reicht das auf die Baustelle gelieferte Material nicht aus», erklärte Prügl, denn die anzugebende Schüttdichte für diese Materialien ist eben die lockere Schüttdichte in kg / m3 nach DIN-EN 1097-3. Von Vorteil ist es, wenn man als Kunde beim Erdenwerk zudem noch einen Wert zur natürlichen Lagerungsdichte nach der Setzung findet, mit dem es sich zuverlässiger rechnen lässt.
Setzungsgrad
Auch der Setzungsgrad ist nachmessbar. Hierzu wird das Substrat bis zur Oberkante in ein definiertes Prüfgefäss eingefüllt, abgestreift sowie mit sechs Schlägen durch einen Proctorhammer bis zur natürlichen Lagerungsdichte verdichtet. Der geschätzte maschinelle Verdichtungszustand wird durch 15 Schläge des Proctorhammers simuliert.
Wasserdurchlässigkeit
Prügl empfahl den Bauleitern eine «Baustellen-Standardausrüstung», mit der sich die wichtigsten Eigenschaften des angelieferten Materials vor Ort auf einfache Art und Weise testen lassen. Hierzu gehört für ihn auch das Überprüfen der Wasserdurchlässigkeit nach FLL: Ein einfaches PVC-Rohr, unten mit einem engmaschigen Sieb ausgestattet, ist ein ideales Hilfsmittel, in welches das Substrat mit sechs Verdichtungsschlägen, wie oben beschrieben, eingefüllt und 24 Stunden in einen Eimer Wasser gestellt wird. Nach dieser Zeitspanne kann man das Rohr entnehmen und füllt nun auf die Probenoberfläche Wasser, dessen Ablaufgeschwindigkeit pro Zentimeter sich mit Metermass und Stoppuhr messen lässt.
Beurteilung der mineralischen Bestandteile und des Wassergehalts
Um die mineralischen Bestandteile der Substrate besser beurteilen zu können, wäscht Prügl gerne den Humus aus. «Glas glitzert im nassen Zustand schön und auch andere Fremdstoffe sind schnell erkennbar», verriet der Fachmann. Auch die Korngrössenabstufung lässt sich mittels verschiedener Siebe schnell und leicht nachvollziehen.
Oftmals ist das Substrat bei der Anlieferung viel zu nass und sollte deshalb weder eingebaut noch verdichtet werden. Einen schnellen Überblick über den tatsächlichen Wassergehalt verschafft hier die Mikrowelle im Bauwagen, in der das Substrat (mind. 700 g) zwei Mal ca. 10 Minuten bei etwa 400 Watt getrocknet wird. Die Differenz des Gewichts entspricht dem Wassergehalt nach DIN 18121. «Nehmen Sie das Material in die Hand, reiben Sie es zwischen den Fingern und schauen Sie es sich genau an. Dreckige Hände gehören zum Job eines Bauleiters und die wichtigsten Geräte eines Landschaftsgärtners oder Planers sind sein Gehirn und seine Hände, die prüfen, ob der Boden oder das Substrat bearbeitbar ist», gab Prügl den Teilnehmern mit auf den Weg.
Anforderungen an Baumsubstrate
Professor Dr. Stephan Roth-Kleyer, zuständig für das Lehr- und Forschungsgebiet Vegetationstechnik an der Hochschule Geisenheim (D), ist mittlerweile überzeugter Verfechter des einschichtigen Aufbaus, wenn es um die Pflanzung von Bäumen in der Stadt geht. Gute Substrate sind nicht nur in der Lage, für die notwendige Balance zwischen den gegenläufigen Anforderungen von Tiefbau und Landschaftsbau zu sorgen, sondern verhindern auch Kapillarbrüche an der Baumgrubenwand und -sohle. «Spätere Sanierungsversuche sind nicht nur extrem kostenintensiv, sondern scheitern meist», so Roth-Kleyers Erfahrung als Sachverständiger. Die Anforderungen an Baumsubstrate wie Struktur- und Lagerstabilität, Pflanzenverträglichkeit, Korngrössenverteilung und Witterungsbeständigkeit, um nur einige Faktoren zu nennen, sind extrem hoch. Deshalb dürfen für diese Mischungen nur geeignete Ausgangsstoffe zum Einsatz kommen.
Mineralische Substratbestandteile
Kesselsand, Lava, Porlith, Rostasche und Ziegelsplitt sind hierbei empfohlene mineralische Bestandteile, wobei die Rostasche und der Kesselsand einen zu alkalischen pH-Wert aufweisen können. Lava verfügt durch ihre kantige Form über eine hohe Lagestabilität bei hoher Druckfestigkeit. Die unterschiedlichen Farben der Lava sagen übrigens nichts über deren Eigenschaften aus. Porlith, das in Messel bei Darmstadt gewonnen wird, ist offenporige Schieferschlacke und zeichnet sich durch hohe Wasserspeicherfähigkeit und einen günstigen pH-Wert aus. Bei Ziegelsplitt ist darauf zu achten, dass nur Mauerziegel oder Dachziegel ohne Verunreinigungen und Mörtelanhaftungen verwendet werden. Die relevanten vegetationstechnischen Eigenschaften können bei Ziegeln je nach Herkunft, Herstellung und Aufbereitung sehr unterschiedlich sein.
Organische Substratbestandteile
Als organische Komponenten, die nicht nur für die Erhöhung der Kationenaustauschkapazität sorgen, sondern auch die Wasser- und Luftkapazität verbessern, eignen sich Rindenhumus, Substratkomposte, Torf, Braunkohlefaserholz, Holzfasern und Kokosfasern. «Leider ist die Rinde, die als Kompost sehr viel Wasser binden kann, mittlerweile durch ihren hohen Brennwert sehr teuer geworden», bedauerte Roth-Kleyer diese Entwicklung. Torf sei allerdings noch teurer und sein pH-Wert liegt meist im sauren Bereich. Komposte bezeichnet er als «Blackbox» und empfiehlt, hier auf die RAL-Gütesicherung zu achten. Zudem rät Roth-Kleyer dringend zum Einsatz von Baumsubstraten, deren technische sowie umweltrelevante Kennwerte bekannt sind und den Vorgaben entsprechen. Hierbei hat er nicht nur das Wohl des Baumes im Blick, sondern beim Thema Gewährleistung auch das des ausführenden Betriebes.