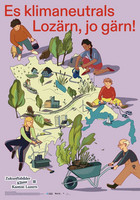D as Auftreten neuer Krankheiten und Schädlinge beeinflusst die Baumartenwahl. Die Platane galt in den 1970er-Jahren als der Stadtbaum, der sowohl mit extremen Standortbedingungen als auch mit der zunehmenden Luftverschmutzung hervorragend zurechtkam. Seit einigen Jahren tritt bei Platanen die Massaria-Krankheit auf. Eine weitere Hauptbaumart, die Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), wird von der Miniermotte befallen. Es stellt sich die Frage, ob diese Baumarten in Zukunft im Stadtgrün noch eine Bedeutung haben werden.
Fabian Dietrich, Baumpflegespezialist mit langjähriger Erfahrung, ist überzeugt: «Es sind nach wie vor wichtige Baumarten. Es wäre falsch, sie wegen der Massaria-Krankheit bzw. der Miniermotte nicht mehr zu pflanzen.» Begründet wird dies damit, dass bei vitalen Bäumen weder die Massaria-Krankheit an Platanen noch der Befall mit der Miniermotte eine Bedrohung darstellen. «Es gilt jedoch abzuwägen, wo eine Pflanzung dieser Baumarten sinnvoll ist und wo nicht.» Massaria beeinträchtigt die Stabilität, Äste können spontan brechen, deshalb sollte, überall wo hohe Sicherheitsansprüche bestehen, nicht unbedingt eine Platane gewählt werden. «Häufig lassen sich die Probleme auch mit einer gezielten Pflege lösen. Wird nur ein geringer Pflegeaufwand gewünscht, ist die Platane nicht die beste Wahl.»
Bei der Rosskastanie gilt: Soll ein Baum bis in den Herbst dicht belaubt und somit ein guter Schattenspender sein, ist sie nicht mehr erste Wahl.
Martin Sonderegger, Leiter Arbeitsgruppe Stadtbäume der VSSG, stellt fest, dass «aufgrund mulitpler Probleme» einige Städte mittlerweile auf Aesculus hippocastanum verzichten. Andere Städte verwenden vermehrt rot- oder gelbblühende Rosskastanien (Aesculus flavum), die kaum oder gar nicht von der Miniermotte befallen werden. Der Platane wird noch immer eine gute Zukunft bescheinigt. Im Gegensatz zu Frankreich, wo Massaria und der Platanenkrebs regional sehr intensiv auftreten, halten sich die Meldungen in der Schweiz in Grenzen. «In Genf, Lausanne und auch im Tessin ist die Entwicklung besonders zu beobachten.»
Matthias Brunner, unabhängiger Baumexperte, verweist auf die «komplexe Krankheitsgeschichte» bei diesen beiden Bäumen: Die Saugschäden der Netzwanze (Corythucha ciliata) nebst Massaria und Apiognomonia auf Platane sowie die Blattfleckenpilze (z.B. Guignardia) und Trockenheitsschäden nebst der Miniermotte auf Rosskastanie zeigen, dass es ein Cocktail ist, der den Bäumen zu schaffen macht. Die Rosskastanie ist mit 9 % aktuell die dritthäufigste Baumart im öffentlichen Grün, die Platane mit 7 % die vierthäufigste. Gut möglich, dass die Bedeutung dieser beiden Baumarten zurückgehen wird, weil sie bei Neupflanzungen eher gemieden werden.»
Axel Heinrich, Mitglied der Forschungsgruppe Pflanzenverwendung der ZHAW, hält die beiden Baumarten für innerstädtische Lagen oder für Parks für wichtig und bewährt. Für ihre Verwendung spricht, dass sie aus Regionen der zukünftigen Klimawandel-arten kommen.
Nebst der Miniermotte, die ein eher ästhetisches Problem mit sich bringt, sind Bakterienkrankheiten wie Pseudomonas syringae pv. aesculi evtl. viel drastischer. Für Spielplätze werden oft grosse fruchttragende Exemplare gesucht. Sie sind jedoch infolge des Nachfragerückganges (fast) nicht verfügbar.
Mehr Diversität gefordert
Um die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und unkontrollierbare Schädlinge zu erhöhen, gilt die Schaffung von Artenvielfalt als Präventivmassnahme. Ziel ist es, eine grössere Vielfalt in den Städten zu erzielen. Wie lässt sich diese Strategie in der Praxis umsetzen?
Martin Sonderegger: Der Ausfall einzelner Bäume wirkt sich meist weniger dramatisch aus als der von Gruppen bzw. Alleen. Eine Ausbreitung ist in einem Mischbestand in der Regel weniger kritisch als in einer Monokultur. In der Praxis treffen aber verschiedene Interessen aufeinander wie Naturschutz, Stadtgestaltung oder Ortsbild. Eine «gesunde» Abwägung ist hierbei gefragt.
Matthias Brunner: Bei invasiven Schädlingen fehlt der natürliche Gegenspieler. Deshalb vermehren sie sich unkontrolliert. Eine generell hohe Artenvielfalt bietet bessere Voraussetzungen, die Folgen solcher Schädlinge rascher auf natürliche Art zu mindern. Bei Quarantäneschädlingen (z. B. Anoplophora glabripennis) ist dagegen rasches Handeln gefragt. Dort ist zu hoffen, dass der Pflanzenschutz mittelfristig Alternativen zu den Baumfällungen bieten kann.
Axel Heinrich: Hierfür fehlt das Element der Grünplanung, wodurch die Biodiversität auch wirklich umsetzbar wird.
Fabian Dietrich: Es muss beim Pflanzen mit einer viel grösseren Artenvielfalt gearbeitet werden als dies in der Vergangenheit der Fall war. Am Beispiel der vor einigen Jahren als sehr guten Alleebaum emporgejubelten Schmalblättrigen Esche (Fraxinus angustifolia ’Raywood‘ ) lässt sich dies gut aufzeigen. Sie wurde entsprechend der Empfehlung häufig gepflanzt. Dann kam das Eschentriebsterben. Heute steht man vor riesigen Problemen. Selbst in Alleen sollten besser nicht die gleichen Baumarten verwendet werden. Über die Artenvielfalt wird viel diskutiert, mit der Umsetzung hapert es aber. Nach wie vor werden Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Spitzahorn (Acer platanoides) regelmässig als Alleebäume verwendet. Sie kommen jedoch nicht zurecht mit Streusalz, Hitze und Abstrahlung. Baumschulen bestätigen, dass diese Baumarten sehr häufig verlangt werden.
Als Referenz gilt die Strassenbaumliste der GALK
Martin Sonderegger: Die Entwicklung ist stark vom Klima abhängig und kann nicht generalisiert werden. So können Bäume, die in südlicherem Klima stehen, in Zukunft auch nördlich von ihren heutigen Idealstandort eine Berechtigung bekommen. Die Liste des Arbeitskreises Stadtbäume der GALK bezieht sich bei der Eignung immer auch auf den aktuellen Standort und somit auf die dort herrschenden Verhältnisse. Allerdings gibt es einige klare Verzichte bei sehr gefährlichen Schadorganismen deren Ausbreitung dringend vermieden werden muss, z. B. Feuerbrand.
Axel Heinrich: Diese Liste ist erprobt, und die Schweizer Städte haben die nicht funktionierenden Schwarze-Liste-, Allergiepotenzial- und Feuerbrandarten entfernt. Das Projekt «Stadtbäume 2021» wird einige neue Infos bringen, aber diese (Langzeit)Erfahrungen sind erst in 10 bis 20 Jahren verfügbar.
Fabian Dietrich: Die Liste kann eine Hilfestellung geben, weil sie viele Informationen zu den Baumarten liefert. Nach wie vor ist die Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia ’Raywood‘) aufgeführt. Auf das Eschentriebsterben wird lediglich verwiesen. Auf Eschen sollte verzichtet werden, einzig die Blumenesche (Fraxinus ornus) scheint weniger anfällig auf das Eschentriebsterben zu sein. Bei den Nadelgehölzen scheiden Föhren wie Waldföhren (Pinus sylvestris) aus, obschon sich diese gut eignen würde im Strassenbereich. Hier ist aber die Rotband- und Braunfleckenkrankheit ein gravierendes Problem.
Welche Arten haben Zukunftspotenzial?
Die Herausforderung, vor der die Verantwortlichen fürs Stadtgrün stehen, ist bereits heute, die optimalen Baumarten für die Folgen des Klimawandels zu finden. Gefragt waren drei vielversprechende Strassen- und Parkbäume.
Martin Sonderegger: Auch hier ist eine Empfehlung immer abhängig von den Bedingungen am Standort. In Hamburg gilt nicht das Gleiche wie in Locarno! Generell ist die Entwicklung folgender Arten zu beobachten: Quercus cerris, Acer opalus und Ostrya carponifolia, um nur drei Baumarten zu nennen, die mit der Entwicklung des Klimas gut zurechtkommen.
Axel Heinrich: Es sollten vor allem grosskronige spätaustreibende Arten sein. Wenn die Stadtstandorte schon wurzelraumtechnisch und klimatisch limitiert sind, sollten doch die besten Ökosystemleistungen (transparenter Schatten) erreicht werden. Eigentlich bräuchten wir Bäume ähnliche, wie Ailanthus altissima (die als invasive Art ausscheidet). Infrage kommen: Fraxinus ornus (Wildform in der ACW Wädenswil), Quercus pubescens, Tilia cordata (beide Wildform), Gleditsia triacanthos, Quercus cerris (nicht in Nassschneelagen), Malus tschonoskii oder Acer monspessulanum (nicht in den Kronen angeschnitten, jung mit Leittrieb gepflanzt) oder Acer campestre (Wildform, sogar gebäudeparallel wachsend, hoch aufgeastet).
Matthias Brunner: Kleinere Gehölze bis 10 m End-
höhe: Cornus mas. Mittlere Gehölze, 10 bis 20 m Endhöhe: Corylus colurna. Grosse Gehölze, 20 bis 30 m Endhöhe: Carpinus betulus und Tilia spec. Ein Patentrezept wird es bei der Wahl von Strassen- und Parkbäumen auch künftig nicht geben.
Fabian Dietrich: Man darf nicht in festgefahrenen Mustern verharren und sollte sich umorientieren.Baumarten, die in südlichen Gefilden heimisch sind bzw. aus südlichen Regionen stammen, gedeihen zunehmend auch bei uns sehr gut. Dagegen haben einheimische Baumarten wie Walnussbaum (Juglans regia), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Spitzahorn (Acer platanoides) Mühe, weil sie empfindlich auf Wetterextreme reagieren. Gute Alleebaumarten sind: Zürgelbaum (Celtis australis), Späths Erle (Alnus x spaethii ) oder Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia). Mehr Beachtung als Alleebaum verdient zudem die Zelkove (Zelkova serrata). Bei sehr engen Platzverhältnissen und wenn eine schöne Blütenpracht gewünscht wird, wären die Löbner Magnolie (Magnolie x loebneri ‘Merrill‘ ) eine gute Wahl oder der Blasenbaum (Koelreuteria paniculata).
Welchen Aspekten sollte darüber hinaus mehr Beachtung geschenkt werden?
Martin Sonderegger: Der Entwicklung von Alternativen zum Streusalz ist grosse Beachtung zu schenken. Begleitpflanzungen wie Stauden bringen eine grosse Vielfalt für die Stadtnatur. Die Pflege von Netzwerken (GALK, VSSG, BSB, BSLA) ermöglicht den Austausch von enorm viel Wissen und Erfahrung, das auch einem gesunden Baumbestand zugutekommt.
Axel Heinrich: Potenzial besteht durch die gehölzbetonten Pflanzensysteme, die den Bäumen mechanischen und thermischen Schutz bieten, die über Transpiration direkt kühlen und die eine natürliche stadtstandorttypische Bodengarebildung bieten.
Matthias Brunner: Nebst Ästhetik und Ökologie werden in naher Zukunft schwindende Finanzen, umweltschonender Pflanzenschutz und der Mut, Neues auszuprobieren, noch mehr Gewicht erhalten.
Stadtgrün 2021
Von «A», wie Amberbaum bis «Z», wie Zürgelbaum werden 20 verschiedene Baumarten auf ihre Tauglichkeit als klimafeste Zukunftsbäume getestet. Über die derzeitigen «Top 20» solcher Zukunftsbäume hinaus testet die LWG an der Landesanstalt in Veitshöchheim sowie auch mit namhaften Baumschulen zusammen weitere neue, insgesamt 250 vermutlich zukunftstaugliche Stadtbaumarten auf Hitze- und Trockenheitsbeständigkeit.