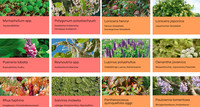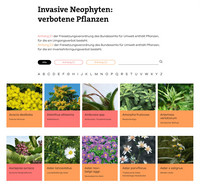Die Schweiz besitzt ein reiches Gartenerbe. Die ICOMOS-Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz verzeichnet rund 30 000 Objekte, viele davon von einer aussergewöhnlich hohen künstlerischen, historischen und städtebaulichen Bedeutung.
Historische Gärten als Kulturdenkmäler
Mehrere dieser Anlagen sind als Gartendenkmäler wichtige Kulturzeugnisse, die es zu erhalten gilt. Nicht nur die «klassischen» Gartendenkmäler fallen darunter wie etwa ein Schlosspark des 18. Jahrhunderts. Auch viele Zeugnisse der Gartenkunst der Moderne gehören dazu. Ihre Hauptsubstanz ist die Pflanze, deren typische Verwendung die Gestaltungsabsicht ihrer Entstehungszeit wiedergibt. Dazu gehören neben heimischen Pflanzen auch zahlreiche Neophyten, also Pflanzen, die nach 1492 nach Europa kamen. Neophyten sind seither unverzichtbarer Bestandteil der Gartenkunst. Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) fordert, «das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, die geschichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kulturdenkmäler des Landes zu schonen, zu schützen sowie ihre Erhaltung und Pflege zu fördern» (NHG, Art.1a). Gegenstand dieses Erhaltungsauftrags sind auch die Gartendenkmäler.
Zwar hält dasselbe Gesetz fest, dass die Ansiedlung von «Pflanzen landes- oder standortfremder Arten» bewilligungspflichtig ist. Es nimmt aber bewusst Gärten und Parkanlagen aus dieser Verpflichtung aus (NHG, Art. 23). Für die Gartendenkmäler ist diese Ausnahme von entscheidender Bedeutung, weil eben viele dieser Pflanzen untrennbarer Bestandteil des Kulturzeugnisses Garten sind.
Invasive Neophyten
Seit 2008 regelt die Freisetzungsverordnung den Umgang mit «invasiven gebietsfremden Organismen» (Art. 4 bis 6 FrSV). Als invasiv werden Organismen eingestuft, die «eine so hohe Bestandesdichte erreichen können, dass dadurch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt oder Mensch, Tier oder Umwelt gefährdet werden können». In der Verordnung sind 18 Pflanzenarten vermerkt (Anhang 2 FrSV), die weder käuflich erworben, gepflanzt, verkauft oder in freier Wildbahn ausgebracht werden dürfen. Dazu gehört beispielsweise der Essigbaum (Rhus typhina).
Während die Freisetzungsverordnung rechtlich verbindlich ist, haben die sogenannte «Schwarze Liste» sowie die «Watch-Liste» keine Gesetzeswirkung. Sie listen Neophyten auf, die erwiesenermassen oder potenziell negative Auswirkungen auf heimische Arten haben. Die Listen führt Info Flora (Stiftung zur Dokumentation und Förderung der Wildpflanzen in der Schweiz). In den Listen sind zahlreiche Gartenpflanzen enthalten, beispielsweise Buddleja davidii (Schmetterlingsflieder), Lupinus polyphyllus (Lupine), Robinia pseudoacacia (Robinie), Aster novi-belgii (Herbstaster) oder Paulownia tomentosa (Blauglockenbaum).
Die Freisetzungsverordnung wird derzeit in den Baureglementen zahlreicher Gemeinden umgesetzt. Ihre Interpretation durch das Musterbaureglement des Kantons Bern beispielsweise fordert mit Verweis auf die Freisetzungsverordnung (Anhang 2 FrSV): «Pflanzen, welche ... die biologische Vielfalt bedrohen ... sind aus den betroffenen Gebieten zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.» Im Kern betrifft dies zwar nur die 18 Pflanzen der Freisetzungsverordnung. Inwiefern das Berner Baureglement den Fokus der Freisetzungsverordnung ausweiten und vorauseilend auch Pflanzen der schwarzen oder Watch-Liste in die «Entfernungspflicht» einschliessen wird, wird die Umsetzungspraxis des Baureglements zeigen. Für die historischen Gärten der Schweiz, insbesondere für ihre Schutz- und Inventarobjekte, wäre dies jedoch eine fatale Entwicklung.
Gartendenkmalpflege
Die moderne Gartendenkmalpflege stellt die Erhaltung der originalen Substanz ins Zentrum ihrer Arbeit. Gartendenkmäler, die ja aufgrund des Pflanzenmaterials «lebende Denkmäler» sind, müssen daher erhaltend gepflegt werden. Das heisst beispielsweise, dass ihre Gehölze nachgepflanzt werden, wenn sie überaltert sind. Bei solch einer Nachpflanzung ist es wichtig, nebst dem alten Pflanzort auch die historische Art und Gattung zu wählen, da sonst die ursprüngliche gestalterische Intention verfälscht wird und der Zeugnischarakter des Gartendenkmals leidet.
Einige der invasiven Neophyten, wie sie auf der schwarzen Liste oder der Watch-Liste geführt werden, sind besonders in den Gärten der Moderne bedeutende Charakterpflanzen. Die Vorliebe jener Epoche für fliederblättrige oder besonders malerische Pflanzengestalten erklärt beispielsweise die vielfache Verwendung von Robinie und Paulownie. Im Werk des Zürcher Landschaftsarchitekten Ernst Cramer (1898 – 1980), eines der bedeutendsten Vertreter der Nachkriegsmoderne in der Schweiz, spielen diese Pflanzenarten eine tragende Rolle. Für die Erhaltung und Pflege der Anlagen jener Epoche würde ein Pflanzverbot oder gar eine Entfernungspflicht die bewusste Zerstörung des wertvollen Kulturzeugnisses bedeuten. Auch das Verbot des Essigbaums durch die Freisetzungsverordnung hat für viele Gartendenkmäler der Moderne weitreichende Konsequenzen. Als Modepflanze der 1950er-Jahre ist der Essigbaum in vielen wertvollen historischen Gärten jener Zeit zu finden. Seine mancherorts aus konservatorischen Gründen erforderliche Nachpflanzung ist inzwischen aber verboten.
Differenzierung tut not
Invasive Neophyten können zu massiven Unterhaltsproblemen in historischen Gärten führen. Pflanzen wie der Staudenknöterich (Reynoutria sp.) oder die Goldrute (Solidago canadensis) erdrücken jede kunstvolle Pflanzung und lassen die Pflegekosten in die Höhe schnellen. Bei wenig robusten Zierpflanzungen hilft hier im Extremfall nur noch der Austausch des Erdreichs, um die Situation in den Griff zu bekommen.
Das Zurückdrängen der invasiven Art wird an dieser Stelle zum gemeinsamen Anliegen von Denkmalpflege und Naturschutz. Doch nicht immer ist die Situation so übersichtlich, denn manchmal sind invasive Pflanzen Teil des historischen Pflanzkonzepts. Umso wichtiger wird in Gartendenkmälern damit einmal mehr die Rolle einer regelmässigen und qualifizierten Gartenpflege. Sämlinge von Pioniergehölzen wie Paulownie oder Robinie werden so problemlos in Schach gehalten. Pflanzen, die sich vor allem durch Wurzelausläufer verbreiten, lassen sich durch eingebaute Wurzelsperren bändigen.
Inwiefern die Pflanze jenseits der Gartengrenzen Schaden anrichten kann, hängt davon ab, was für ein Umfeld vorliegt – ob hinter dem Gartenzaun der nächste Garten oder etwa ein Landschaftsschutzgebiet anschliesst. An die Stelle eines pauschalen Verbots einer Pflanzenart in einem historischen Garten sollte deshalb eine differenzierte und auf die jeweilige Situation abgestimmte Vorgehensweise treten, welche die Anliegen des Naturschutzes und der Denkmalpflege gleichermassen berücksichtigt. Die kulturhistorische Bedeutung der Anlage, die Pflegeressourcen oder die Beschaffenheit des Gartenumfelds können hierbei einbezogen werden.
Wege zu einem Dialog im historischen Garten
Denkmalpflege und Naturschutz teilen dieselben geistigen Wurzeln und ein verwandtes konservatorisches Interesse. Obwohl beide einem gesellschaftlichen Bedürfnis entsprungen sind, müssen sie sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, sie seien rückwärtsgewandt und verhinderten den wirtschaftlichen Fortschritt. In dieser Situation und angesichts der gesetzlichen Grundlagen von Naturschutz und Denkmalpflege ist es dringend notwendig, partnerschaftliche Lösungen für gemeinsame Probleme zu suchen und zu finden. Voraussetzung dafür ist nicht nur die eigene Kompetenz, sondern auch die Kenntnis der Ziele des Partners im anderen Fachbereich. Es ist wieder an der Zeit, sich über diese Ziele auszutauschen.