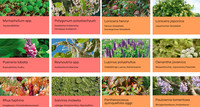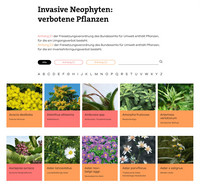Max Liebermann gehört zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Geboren in Berlin und ausgebildet in Weimar, zog es ihn zum Leben und Arbeiten nach Paris, München und in die Niederlande, bevor er 1884 nach Berlin zurückkehrte. Er war, im Unterschied zu manch anderen Impressionisten, schon zu Lebzeiten erfolgreich und wohlhabend. 1920 wurde er unter anderem zum Präsidenten der Preussischen Akademie der Künste berufen.
Bereits 1909 hatte er ein Grundstück am Wannsee erworben, wo er sich als Ausgleich zum Leben und Arbeiten in der Stadt ein Sommerhaus errichten liess. Vorbild dafür waren die Hamburger Patriziervillen. Für den Entwurf und die weiteren Planungen konnte er den damals berühmten Architekten Paul Otto August Baumgarten gewinnen. Im Sommer 1910 bezog Liebermann dann sein «Schloss am See».
Zum Landsitz gehörte ein aus zwei Parzellen zusammengefasstes Grundstück mit direktem Bezug zum Wasser. Den etwa 7000 m2 grossen Garten liess der Maler von Landschaftsarchitekt Albert Brodersen (1857-1930), dem späteren städtischen Gartendirektor Berlins, gestalten. Die Ideen dazu lieferte jedoch Max Liebermann selbst, die er zusammen mit dem Hamburger Gartenreformer Alfred Lichtwark (1873-1914) entwickelt hatte. Der Garten mit engem Bezug zur Villa fand später als Motiv Eingang in Liebermanns Spätwerk. Viele Gemälde dienten als Recherchematerial für die Rekonstruktion des Gartens.
Bauerngarten als Entree
Der 1910 gleichzeitig mit der Villa fertiggestellte Garten folgte den Prinzipien der Gartenreformbewegung um 1900. Dazu gehörten unterschiedliche historische Gartenelemente wie von Buchsbaum eingefasste Beete, Kastenlinden, Hainbuchenhecken sowie ein Rosen- und Nutzgarten. Hinzu kamen Sichtachsen und klare Bezüge zwischen den verschiedenen Gartenbereichen. Vor dem weit zurückversetzten Haus an der Strassenseite und dem Pförtner- und Gärtnerhäuschen entstand ein grosser und unüblich tiefer, lang gezogener «Vor»-Garten, üppig mit Nutzpflanzen und Blumen gestaltet. Die axialsymmetrisch angeordneten Beete wurden von Buchs begrenzt. Dieser Stauden- und Gemüsegarten war norddeutschen Bauerngärten nachempfunden. Ein zentraler Weg, der von Sommerblumenrabatten und Nutzbeeten begleitet wurde, erschloss ihn durchgängig und mündete auf die strassenseitige Loggia der Villa, die von zwei dorischen Säulen flankiert war. Zwischen dem Garten und dem Vorplatz mit Rasenteppichen, Buchskugeln und Kieswegen schuf eine Reihe Kastenlinden die räumliche Strukturierung. Zur Bepflanzung gehörten aus heutiger Sicht auch historische und insofern selten gewordene Pflanzen wie Mexikanische Sonnenblumen (Thitonia rotundifolia, T. diversifolia), aber auch Rittersporne (Delphinium), Sonnenhüte (Rudbeckia und Echinacea) sowie Sommer- und Herbstdahlien (Dahlia). Im Gemüsegarten wuchsen unter anderem Kohl, Salate, Bohnen und Tomaten, die in der Küche Verwendung fanden und bei Tisch auch verzehrt wurden. Die Verbindung von Gemüse- und Staudengarten gilt als typisch für Liebermanns reformorientiertes Gartenkonzept.
Wiese bis zum See
Auf der Gartenseite zum Wannsee lag direkt vor dem Gebäude die Blumenterrasse, ein Sitzbereich im Freien mit einer tiefer liegenden Rabatte davor. Im Anschluss erstreckte sich mittig eine wiesenartige Rasenfläche bis zum Seeufer. Sie wurde im Süden flankiert vom Birkenweg, mit unregelmässig und auch im Weg gepflanzten Betula-Arten, und einem schmalen, lang gezogenen Hecken- und Rosengarten auf der gegenüberliegenden Nordseite. Die drei Heckengärten hatten nach Alfred Lichtwarks gartenkünstlerischen Ideen eine besondere Bedeutung. Die von Hainbuchen (Carpinus betulus) eingefassten «grünen Kammern» sollten Spannung erzeugen und die Neugier wecken auf das, was sich hinter den Hecken im jeweils nächsten Kabinett befand. So hatte der erste Heckengarten einen quadratischen Grundriss, der zweite war oval und der dritte rund mit einer Vierteilung. Das Band der Gärten war von einem geraden Weg durchzogen, an dessen Anfang eine weisse Gartenbank stand. Nur dieser Platz erlaubte den ungehinderten Blick durch die gesamte Abfolge der Heckengärten bis zum Wannsee. Dort bildeten ein Teepavillon und ein Steg ins Wasser den Abschluss. In seinen späten Lebensjahren malte Liebermann sowohl den Bauerngarten mit der Hausfront, insbesondere aber die Seeseite mit dem Birkenweg und den Heckenkabinetten immer wieder gerne. Schon damals war der Garten insofern eine Art begehbares Gemälde.
Umnutzung und Niedergang
Nach Liebermanns Tod 1935 ging das Anwesen an seine Frau Martha, geb. Marckwald, über. Sie musste es zurzeit des Nationalsozialismus weit unter Wert zwangsveräussern. Als Jude hatte Liebermann bereits seit 1933 Arbeitsverbot und seine Werke, wie die aller jüdischen Künstler, durften nicht mehr ausgestellt werden. Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Liebermann-Villa zu einem Lazarett umfunktioniert und nach 1945 in ein reguläres Krankenhaus. Anfang der 1970er-Jahre wurde sie als Vereinsheim eines Tauchsportclubs genutzt. Die Aussenbereiche dienten vorwiegend als Bootslager. Der Zustand des Gebäudes verschlechterte sich zunehmend und die Strukturen im Garten gingen trotz einer gewissen Pflege mehr und mehr verloren.
Sanierung/Restaurierung
Liebermanns Erben erhielten das Anwesen 1951 zurück und verkauften es sieben Jahre später an das Land Berlin, das es verpachtete. In den Jahren 1993/94 erstellte der Berliner Landschaftsarchitekt Reinald Eckert ein Gutachten als Grundlage für die Wiederherstellung des Gartens. Die 1995 gegründete Liebermann-Gesellschaft übernahm das Gebäude und den Garten mit der Absicht, ein privates Museum zu betreiben und den Garten wiederherzustellen. Das Land Berlin blieb Eigentümerin, die Kosten für den Umbau zum Museum, die Sanierung und Rekonstruktion musste der Verein aber selbst aufbringen.
2002 begannen die Bauarbeiten am Gebäude, zwei Jahre später die Rekonstruktion des Gartens. Trotz vieler Eingriffe und der reduzierten Pflege in den Jahrzehnten zuvor war noch eine gewisse Originalsubstanz vorhanden, so etwa die Stützmauern und Treppen auf der Wannseeseite, die Lindenreihe im Vorgarten oder Hainbuchenreste des Heckengartens. Aufgrund dieser Funde, mithilfe alter Fotos und der Gemälde Max Liebermanns sowie Erinnerungen von Zeitzeugen, die die umfangreichen historischen Recherchen ergänzten, konnte der Garten originalgetreu rekonstruiert werden. Eine kleine, auf der Nordseite noch fehlende Parzelle kam erst später zum Grundstück zurück und führte zur vollständigen Wiederherstellung der Heckengärten sowie der Obstwiese am Teepavillon.
Der Garten wurde unter der Leitung von Landschaftsarchitekt Reinald Eckert durch Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus und weiterer Gewerke detailgenau wiederhergestellt, inklusive aller baulichen Elemente wie der Terrasse, dem Otterbrunnen, dem Pavillon und dem Steg am See. Bei der Neubepflanzung kamen auch die Birken zurück, die teilweise im Weg auf der Südseite stehen. Im Bauerngarten wachsen wieder Nutzpflanzen und Sommerstauden, während das Pförtner- und Gärtnerhaus den Eingang mit Kasse und Museumsshop beherbergt. Der Garten ist gut eingewachsen und wird regelmässig gepflegt. |